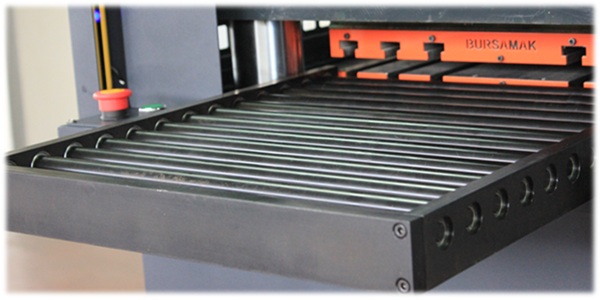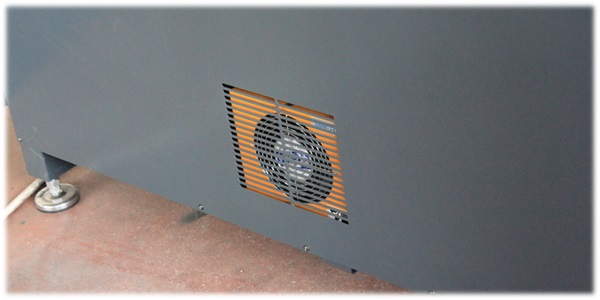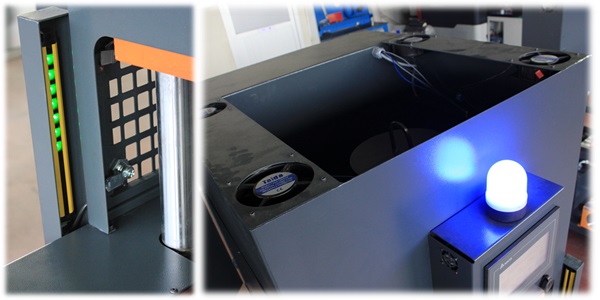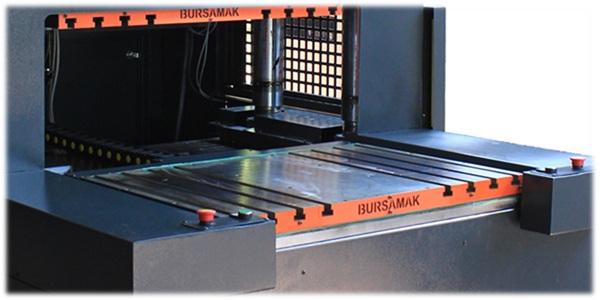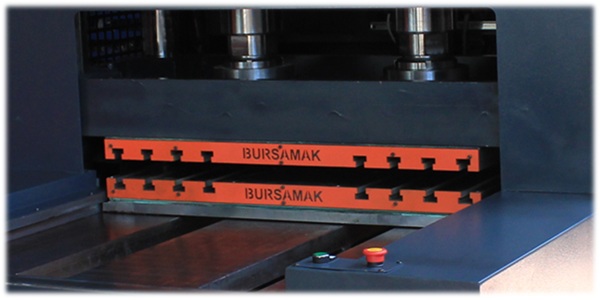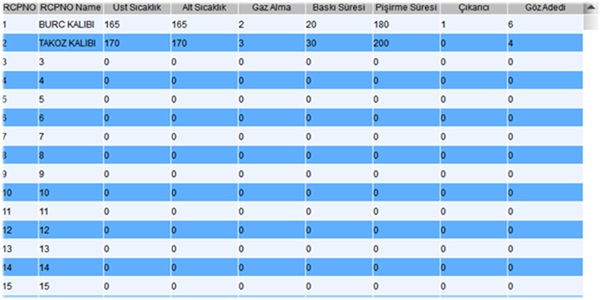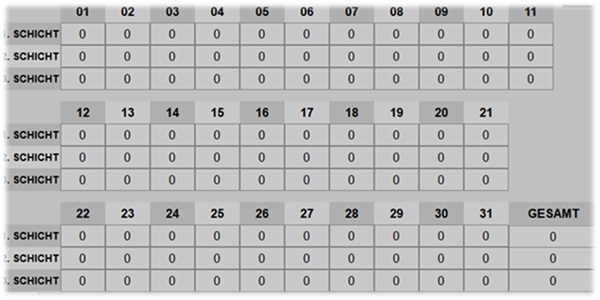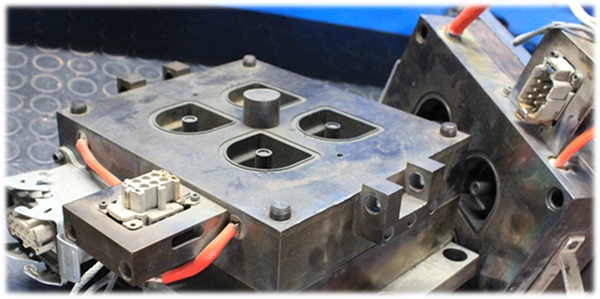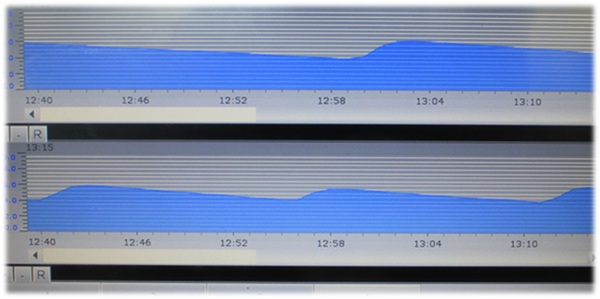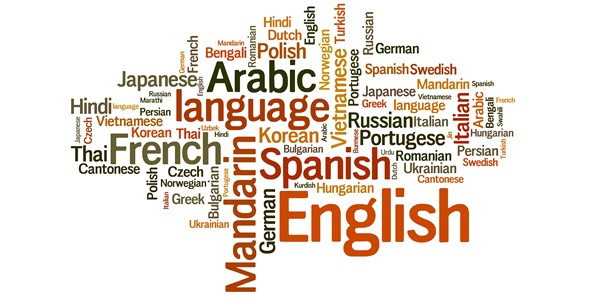|
|
|
|
Standard Vulkanisations Presse |
ECO Vulkanisations Presse |
Labor Vulkanisations Presse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unsere Vulkanisationspressen Modelle
|
|
|
|
| MODELL | Standard Vulkanisation Presse | ECO Vulkanisations Presse | Labor Vulkanisation Presse |
| Hydraulischer Schiebetisch | Standard | --- | --- |
| Mittlerer und seitlicher Extraktor Mechanismus | Option | Option | --- |
| Hydrauliköl-Kühleinheit | Standard | Standard | --- |
| Belüftung | Standard | Standard | Standard |
| Sicherheits-Lichtschranke | Standard | Standard | --- |
| Automatische Entgasung | Standard | Standard | Standard |
| Automatischer Betrieb und Abschaltung | Standard | Standard | --- |
| Elektronische Drucküberwachung | Standard | Standard | Standard |
| Automatische Schmierung | Option | Option | --- |
| Form Parameter Speicher | Standard | Standard | --- |
| Warnung vor Bedienung Verzögerung | Standard | Standard | --- |
| Heiztechnik | Standard | Standard | Standard |
| Schicht Produktionsverfolgung | Option | Option | --- |
| Direkte Formheizung | Option | Option | --- |
| Serververbindung und Fernsteuerung | Option | Option | --- |
| Temperatur Statistik der Tabellen | Standard | Standard | --- |
| Energieverbrauch Verfolgung | Option | Option | --- |
| Mehrsprachiges Bedienfeld | Standard | Standard | --- |
Standard Vulkanisations Presse |
ECO Vulkanisations Presse |
Labor Vulkanisations Presse |
|
BROSCHÜRE |
BROSCHÜRE |
BROSCHÜRE |
Yaylacık mh. 44. sk. No:13 16280 Nilüfer / BURSA /TURKEY
+90 224 3611940-41 info@bursamak.com